Seien auch Sie am Tag der Lehre dabei, diskutieren Sie mit und lassen Sie sich inspirieren!
(Anmeldung mit Uni-Ulm-Account. Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Uni Ulm-Account melden sich bitte per E-Mail an zle(at)uni-ulm.de an)

26. November 2025, ab 11:30 Uhr
Auf dem Tag der Lehre 2025 diskutieren Lehrende, Studierende und Mitarbeiter*innen der Universität Ulm und darüber hinaus über innovative Lehrkonzepte, Ideen und Erfahrungen rund um das Studieren, Lehren und Prüfen an der Universität Ulm. In diesem Jahr widmet sich der Tag der Lehre dem zentralen Thema „umdenken - umsetzen - lehren - mitgestalten“. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir uns damit beschäftigen, wie Lehre und Studium an der Universität Ulm so gestaltet werden können, dass Vernetzung, Zusammenarbeit und gegenseitige Inspiration selbstverständlich Teil unseres Lehr- und Studienalltags werden. Wir möchten gemeinsam Ideen entwickeln, wie Lehrende, Studierende und Mitarbeitende voneinander lernen, neue Perspektiven gewinnen und innovative Konzepte gemeinsam vorantreiben können. Der Tag der Lehre 2025 bietet dafür eine offene Plattform – ein Raum für Dialog, kreative Impulse und nachhaltige Kooperationen.
(Anmeldung mit Uni-Ulm-Account. Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Uni Ulm-Account melden sich bitte per E-Mail an zle(at)uni-ulm.de an)
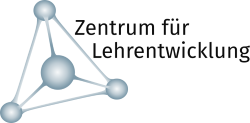
Bitte melden Sie sich über das Fortbildungsportal der Universität Ulm zum Tag der Lehre an:
www.uni-ulm.de/fortbildungsportal (Login mit kiz-Account)
Externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer melden sich bitte per E-Mail an zle(at)uni-ulm.de an.
Lehrentwicklung im Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Kooperation
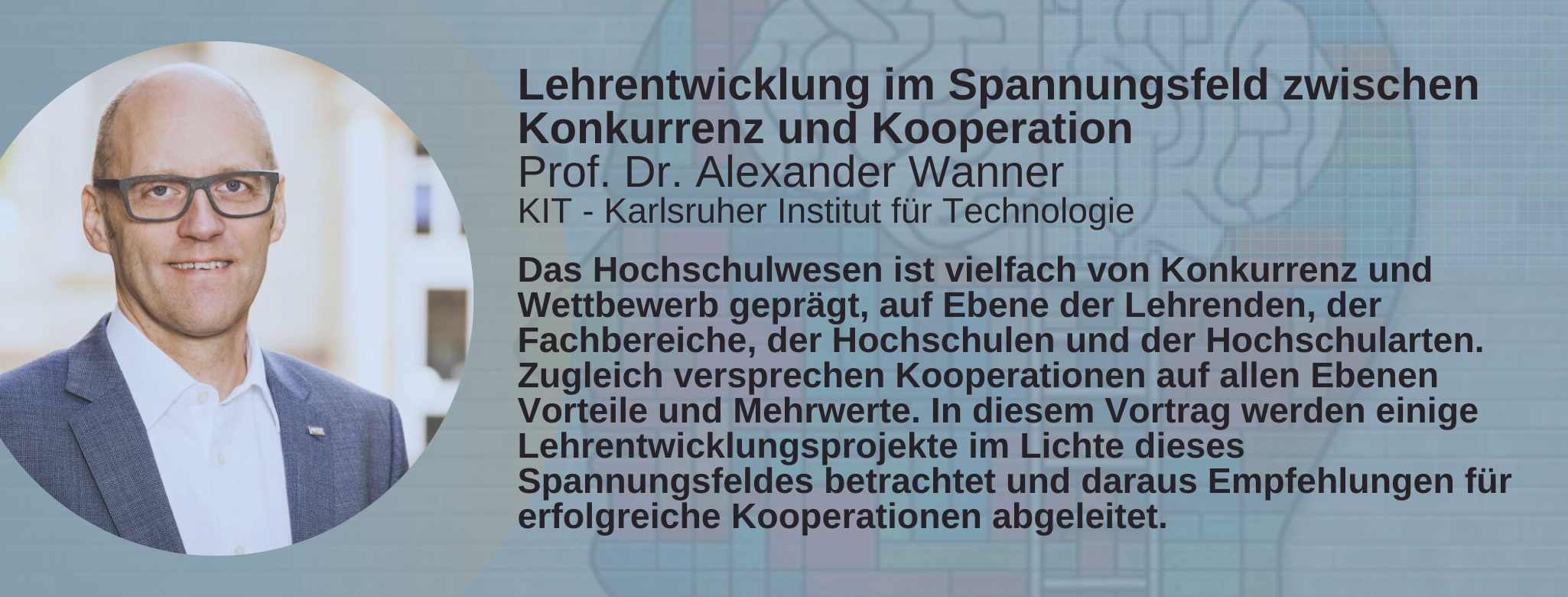
Das Projekt “UGo! UUlm Global Teaching Labs” wird von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre vom 01.10.2025 bis 31.12.2029 gefördert. Ziel des Projekts ist, die Internationalisierung in der Lehre an der Universität Ulm zu stärken und zu fördern. Das Projekt verfolgt dabei drei Maßnahmen:
Das Projekt UGo! stellt sich auf dem Tag der Lehre vor, Sie erfahren auch mehr über die Möglichkeit der Förderung in den Global Teaching Labs.
Mit den Ulmer Lehrinkubatoren fördert die Universität Ulm seit 2023 innovative Lehrideen und -konzepte. Die großzügige finanzielle Ausstattung dieser universitätsinternen Förderung soll Lehrenden die Freiräume ermöglichen, ihre Konzepte zur Umsetzung zu bringen. Der stetige Austausch unter den Geförderten sowie die begleitende Beratung durch das Zentrum für Lehrentwicklung unterstützen sie in diesem Prozess. In der Ausschreibungsrunde 2025 wurden drei Projekte gefördert, die sich auf dem Tag der Lehre kurz vorstellen.
Programmieren ist heute in nahezu allen Fachbereichen der Hochschullehre relevant.
Gleichzeitig stellt die Vielfalt an Programmiersprachen, Tools und Vorkenntnissen eine große Herausforderung für eine effiziente und skalierbare Lehre dar. Mit dem Projekt CODEcenter erproben wir eine zentrale, webbasierte Programmierplattform, die auf bestehender Infrastruktur (bwCloud) betrieben wird. Unser Ziel ist eine personalisierte und nachhaltige Programmierausbildung über alle Fachbereiche hinaus. Studierende erhalten unmittelbares, lernzielorientiertes Feedback und können über Bonusaufgaben individuell gefördert werden.
Lehrende profitieren von automatisierten Korrektur- und Analysefunktionen. Das Selbststudium wird gefördert, fehlende Kompetenzen automatisch erkannt und gezielt in Tutorien behandelt.
Das geplante englischsprachige Ethics-By-Design-Lehrformat richtet sich an MA-Studierende und Promovierende des Fachbereichs Informatik. Als forschungs- und praxisnahes Lehrangebot befähigt es Nachwuchsforscher*innen, ethische Überlegungen von Beginn an als integrierten Bestandteil eines technologischen Designprozesses zu begreifen. Im Rahmen des Lehrformats werden didaktisch strukturierte, modulare Selbstlerneinheiten in Videoformat zu ethisch-philosophischen Grundlagen und spezifischen digitalethischen Fragestellungen mit einer individuellen Projektbegleitung kombiniert. Letztere beinhaltet regelmäßige Ethics-By-Design-Sprechstunden und bedarfsgerechte Workshops, in denen die Teilnehmenden Unterstützung bei der ethischen Reflexion auf ihr eigenes Projekt erhalten.
Mit neurowissenschaftlichen Methoden können wir Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Sprache, Motorik, Bewusstsein und Körperprozesse messen und Interventionen entwickeln. Das Projekt STARK rückt die experimentelle neuro-psycho-physiologische Forschung mit Themen gesellschaftlicher und akademischer Relevanz in den Mittelpunkt der Lehre. Ziel des forschungsorientierten Lehrprojekts ist es, insbesondere weibliche Studierende für neuropsychophysiologische Methoden und Anwendungen im Bereich Neurowissenschaft, Technik und Gesundheit auszubilden. Durch Hands-On Seminare, Forschung zum Anfassen und spezielle Onboardingmaßnahmen sollen sie zu methodischen Expertinnen werden und aktiv an innovativen und exzellenten Lösungen mitarbeiten. Das Projekt ergänzt die bestehenden neurowissenschaftlichen Lehrangebote der Universität in entscheidender Weise.

„Bionopoly“ als gamechanger? Welchen Effekt hat Gamification im Biochemie-Seminar auf Lernerfolg, Motivation und Aktivität von Studierenden der Humanmedizin
Eva Stapfer1, Dr. Ernestine Saumweber1, Dr. Achim Schneider2 & Prof. Dr. Susanne Kühl1
(Medizinische Fakultät | 1Institut für Biochemie und Molekulare Biologie, 2Studiendekanat der Medizinischen Fakultät)
Zielsetzung: Gamification zeichnet sich durch den Einsatz von Spielelementen in einem Nicht-Spielkontext aus. Es wird häufig im Unterricht eingesetzt, um zu motivieren und aktivieren. Insbesondere die langen Biochemie-Praktikumstage zeigten sich wenig motivierend für Studierende der Humanmedizin. Folglich war das Ziel, Auswirkungen von Gamification auf Studierende in den Seminaren des Praktikums zu untersuchen.
Methoden: Diese Studie wurde im vierten Semester der Humanmedizin an der Universität Ulm durchgeführt. Die Studierenden wurden in zwei Studiengruppen eingeteilt, die sich im Unterrichtskonzept unterschieden. In der Kontrollgruppe erhielten die Studierenden einen traditionellen, interaktiven Präsenzunterricht mit offenen Fragen. In der Gaming-Gruppe wurde das Quizspiel „Bionopoly“ eingeführt und anhand eines gamifizierten didaktischen Konzepts unterrichtet. Der Lernerfolg wurde durch einen Multiple-Choice-Test zu Beginn und am Ende des Kurstages gemessen. Zufriedenheit, Motivation und ein möglicher anhaltender Aktivierungseffekt wurden durch einen Fragebogen analysiert.
Ergebnisse: Die Studierenden des gamifizierten Konzepts erzielten an Ende des Kurstags im Wissenstest höhere Punktzahlen als Studierende des traditionellen Unterrichtskonzepts. Darüber hinaus motivierte das gamifizierte Konzept die Studierenden deutlich mehr. Weiterhin hatte Gamification einen stabilisierenden Effekt auf Motivation, Konzentration und Interesse der Studierenden.
Fazit: Unsere Studie zeigt, dass Gamification eine motivierende und aktivierende Lernumgebung an langen Unterrichtstagen für Studierende der Humanmedizin schaffen kann.
Keywords: Humanmedizin, Gamification, Biochemie
Jakob Roth1,2, Delia Grünzweig1,2, Johannes Lehmann1,2, Carina Seibert1,2 & Prof. Dr. rer. nat. Holger Barth1
(Medizinische Fakultät | 1Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Naturheilkunde, 2Tutor:in)
In Pharmakologie problemorientiertes Lernen bearbeiten Studierende klinische Fallbeispiele in Kleingruppen aus dem 5. und 6. Fachsemester mit einer TutorIn. Anhand realitätsnaher Szenarien sollen der Umgang mit Medikamenten und Behandlungsstrategien erlernt und klinische Entscheidungsfindungen trainiert werden.
Bisher eingesetzte digitale Werkzeuge wie mDecide ermöglichen Studierenden, aus einem Katalog klinischer Handlungsoptionen zu wählen, durch die statisch ein entsprechende Fallabschnitt dargestellt wird. mDecide bietet somit eine flexible Struktur der Fallgeschichten, reagiert jedoch nur eingeschränkt auf individuelle Entscheidungen der Gruppen. Um die Interaktivität zu erhöhen und den Lernprozess stärker an reale klinische Dynamiken anzunähern, wurden durch TutorInnen neue digitale Konzepte entwickelt. Ziel ist die Entwicklung einer digitalen Plattform. Dabei sollen der klinische Fall und die Elemente der Wissensvermittlung stärker verzahnt und darüber hinaus spielerische Elemente integriert werden.
Zwei Konzepte wurden entwickelt und in POL-Stunden getestet: ComicPOL, bei dem Fallverläufe in comicartigen Szenen dargestellt werden und die Gruppe nach jedem Abschnitt aus vier Handlungsoptionen wählt, sowie polGPT, das mithilfe einer generativen künstlichen Intelligenz dynamisch auf studentische Entscheidungen reagiert und so individualisierte Fallverläufe ermöglicht. Beide Konzepte integrieren spielerische Elemente, fördern aktive Beteiligung und eröffnen neue Möglichkeiten für die Wissensvermittlung in PharmakologiePOL.
Keywords: Interaktivität, Gamifizierung, digitale Plattform, Künstliche Intelligenz
Rüdiger Fiebig & Lydia Jeske
(Stabsstelle QBR)
Generative KI-Tools wie z.B. ChatGPT und die Veränderungen, die ihre Nutzung in unserem Alltag mit sich bringt, sind bereits seit einigen Jahren Teil intensiver gesellschaftlicher Diskussion. Insbesondere in der Bildungswelt ergeben sich durch immer leistungsfähigere LLM-Systeme erhebliche Auswirkungen, die die Art, wie wir lernen und lehren, grundlegend verändern.
Daher hat die Stabsstelle QBR in ihrer jährlichen Studierendenbefragung 2025 erneut Kenntnisstand, Nutzung und Erwartungshaltungen beim Einsatz von KI-Tools im Studium erhoben.
Unser Beitrag am Tag der Lehre wird die zentralen Ergebnisse zum Thema KI-Tools aus der Befragung vorstellen und soll in der anschließenden Diskussion sowohl Studierenden als auch Lehrenden Raum für den Austausch und die Diskussion der Ergebnisse und der daraus abzuleitenden Folgerungen geben.
Keywords: KI, Künstliche Intelligenzt, GPT, Studierendenbefragung
Dr. Daniel Schropp1, Prof. Dr. Michael Hiete2 & Lea Raczkowski1
(1Zentrum für Lehrentwicklung, ²Fakultät für Naturwissenschaften | Professur für Wirtschaftschemie im Institut für Theoretische Chemie)
EcoSocMan, kurz für "Awareness through Science Education for Ecosystem Ecology, Society and Management", ist ein zukunftsweisendes Projekt, das über drei Jahre hinweg das Wissen und Bewusstsein für klimabedingte Umweltveränderungen in ausgewählten Ökosystemen Europas steigern soll. Im Mittelpunkt stehen drei zweiwöchige Summer Schools, die in enger Zusammenarbeit mit Projektpartnern aus Estland, Tschechien, Frankreich, Deutschland und der Ukraine durchgeführt werden.
EcoSocMan als internationales Projekt fördert den Austausch zwischen Studierenden, Lehrenden und Experten und schafft ein europäisches Netzwerk für interdisziplinäres, kooperatives und entdeckendes Lernen. Dabei werden Akteure aus den Natur- und Sozialwissenschaften sowie aus der Zivilgesellschaft integriert, um eine umfassende europäische Perspektive auf die Herausforderungen des Klimawandels für Ökosysteme und deren Management zu entwickeln. Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die Produktion kurzer Videoclips durch Studierende, die zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in ganz Europa beitragen sollen.
In einer Zeit, in der der Klimawandel eine globale Herausforderung darstellt, ist es wichtig, dass Europa als vereinte Gemeinschaft zusammenarbeitet. EcoSocMan bietet Studierenden die Möglichkeit, interdisziplinäres Wissen zu erwerben und sich mit Kommilitonen aus verschiedenen Ländern zu vernetzen. Durch diese internationale Zusammenarbeit fördern wir ein gemeinsames Verständnis für ökologische und soziale Fragestellungen und stärken die Fähigkeit, nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
Das Projekt trägt damit dazu bei, eine informierte und engagierte Generation von Fachkräften hervorzubringen, die in der Lage ist, die komplexen Herausforderungen des Klimawandels in einem europäischen Kontext anzugehen.
Keywords: interdisziplinär, international, Exkursion
Dr.-Ing. Jens Friedland & Prof. Dr.-Ing. Robert Güttel
(Fakultät für Naturwissenschaften | Institut für Chemieingenieurwesen)
Der zugrundeliegende Lehrinkubator dieses Beitrags untersucht eine Lernumgebung zur Angleichung heterogener Lernstände in Kerndisziplinen zu Beginn des Master-Programms. Durch die internationale Ausrichtung des Studiengangs Chemical Engineering kommen kulturbedingte Heterogenität bei personalen und sozialen Kompetenzen hinzu.
Die Lernumgebung kombiniert eine Wiederholung von fachlichen Inhalten mit neuen Kompetenzen im Bereich der digitalen Werkzeuge. Konkret werden einfache Sachverhalte aus Kerninhalten des Bachelorprogramms auf eine höhere Komplexitätsstufe gehoben, so dass einfache Berechnungsmethoden nicht mehr anwendbar sind. Die Lösung dieser Fragestellungen werden daher rechnergestützt in zufällig zusammengestellten Gruppen bearbeitet. Das ausgearbeitete Protfolio-Element wird im Anschluss in einem Blind-Peer-Review Verfahren von einer anderen Gruppe kritisch begutachtet und Feedback gegeben.
Hierbei tritt an drei Stellen eine Reflexion des Lernstandes ein: In der Interaktion mit anderen Studierenden während der Ausarbeitung, bei der kritischen Durchsicht anderer Berichte und durch das Feedback zur eigenen Ausarbeitung.
Durch einen Kompetenztest, der jeweils am Anfang und Ende des Semesters durchgeführt wurde, konnte ein deutlicher Lernfortschritt festgestellt werden. Herausforderungen bei der Durchführung wurden schriftlich und in Feedbackgesprächen evaluiert.
Der Beitrag zeigt die Erfolge und Hürden, die in zwei intensiven Jahren Lehrinkubator ermittelt werden konnten.
Keywords: Portfolio Prüfung, Peer-Review, heterogene Lerngruppen
Luca Cermak1 & Simon Maier2
(Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften | 1Institut für Volkswirtschaftslehre, 2Institut für Nachhaltige Unternehmensführung)
Die Ultimate League for Mastery in Applied Economics (ULMA) ist eine hybride VWL-Olympiade an der Universität Ulm, die Studierenden einen spielerischen Zugang zu ökonomischem Wissen eröffnet. Im Format eines internationalen Wettbewerbs treten Ulmer Studierende gemeinsam mit Kommiliton:innen aus über 30 Universitäten und mehr als 25 Ländern an. Das Konzept verbindet „Internationalisation@Home“ mit Wissenstandsabfragen, fachübergreifenden Elementen und einem gamifizierten Lernansatz.
Die Olympiade ist didaktisch eng mit den Lehrinhalten der Volkswirtschaftslehre verknüpft (Mikro-/Makroökonomik, Ökonometrie, Finanzwirtschaft), ermöglicht aber zugleich interdisziplinäre Zugänge für Studierende angrenzender Studiengänge wie Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsphysik oder Wirtschaftschemie. Durch die Bearbeitung praxis- und forschungsnaher Aufgaben wird theoretisches Wissen spielerisch gefestigt, analytische Kompetenzen gestärkt und interkultureller Austausch gefördert.
Nach der erfolgreichen Premiere 2024 mit über 80 Teilnehmenden aus 25 Ländern wird die Olympiade im Wintersemester 2025/26 fortgeführt. ULMA steigert Motivation und Lernfreude, sichert Lehrqualität und fungiert als Marketinginstrument für das neue englischsprachige Masterprogramm Wirtschaftswissenschaften. Damit zeigt das Projekt, wie digitale Lehrinnovationen Reichweite, Sichtbarkeit und Qualität zugleich erhöhen können.
Keywords: Digitalisierung in der Lehre, Wissenstandsabfrage, Kompetenzorientierung, Gamification
Susan Czogalla
(Fakultät für Naturwissenschaften)
Wie erreichen wir potenzielle Studierende und wie können wir sie für Zukunftsthemen begeistern und in aktuelle Diskurse einbinden? Wie informieren wir die Öffentlichkeit über die Dinge, die hier bei uns erforscht werden? Und ist Gameification auch eine Möglichkeit Wissenschaftsthemen zu vermitteln?
Mit kreativen Ideen haben Doktorand*innen aus der Physik das komplexe Feld der Quantenphysik Ulmer Schülerinnen und Schülern näher gebracht. In „Zirkeltraining“-Manier wurde das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet, bestaunt, erklärt, bespielt und erprobt, eine Vielfalt von Experimente ermöglichte Anknüpfungspunkte für alle Wissensniveaus.
Nach einer erfolgreichen Veranstaltung mit 120 Schüler*innen aus Physikkursen und 30 Laborbesucher*innen bleibt die Frage, wie man ein solch aufwendiges Projekt nachhalten kann und ob sich Universitäten nicht überhaupt mehr in die Wissensvermittlung an Schulen einbringen sollten.
Keywords: Wissensvermittlung, Studierendengewinnung, Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Cornelia Estner1 & Clarissa Gobiet2
(Nachwuchsakademie ProTrainU, Arbeitsstelle Hochschuldidaktik im HDZ Baden-Württemberg1 & Nachwuchsakademie ProTrainU2)
ProTrainU ist die zentrale Koordinationsstelle, um Nachwuchswissenschaftler*innen an der Universität Ulm u.a. in folgenden Bereichen bestmöglich zu unterstützen:
- allgemeine Beratung
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten für überfachliche Qualifikationen
- Karriereentwicklung
- Konfliktmanagement im Promotionswesen
- Anschubfinanzierungen für Postdoktorand*innen und Nachwuchswissenschaftler*innen.
Zudem werden Vernetzungsmöglichkeiten und Formate zur Wissenschaftskommunikation angeboten, das bekannteste ist der "Science Day". Hier haben einmal pro Jahr Nachwuchswissenschaftler*innen aus allen Disziplinen der Universität Ulm die Möglichkeit, eine eigene, innovative Forschungsidee vor einem breiteren Publikum mittels eines maximal fünfminütigen Pitches anschaulich, konkret und ohne Hilfe von digitalen Medien auf Deutsch oder Englisch vorzustellen. Am Ende der Veranstaltung findet die Siegerehrung statt, innerhalb dieser für den ersten Platz 50.000 Euro und für den zweiten Platz 30.000 Euro für die beste gepitchte Forschungsidee verliehen wird.
Keywords: Wissenschaftlicher Nachwuchs, Doktorand*innen, Post-Doktorand*innen, ProTrainU, Science Day
Dr. Hannah Flach
(Medizinische Fakultät | Institut für Biochemie und Molekulare Biologie)
Gamification gewinnt als didaktisches Werkzeug zunehmend an Bedeutung, um Motivation und Lernerfolg im Bildungsbereich zu steigern. Besonders im Medizinstudium bieten Spielelemente Potenzial, da die vorklinischen Fächer von Studierenden oft als wenig motivierend wahrgenommen werden. Der Bericht Lehre 2023 der Universität Ulm dokumentiert für diesen Studienabschnitt einen Rückgang der Zufriedenheit, wovon auch das Biochemiepraktikum betroffen ist.
Vor diesem Hintergrund habe ich im Versuch „Enzyme und Enzymkinetik“ des Praktikums „Biochemie und Molekularbiologie“ erstmals Gamification-Elemente eingeführt. Grundlage war die beliebte Buch- und Filmreihe Harry Potter . Die insgesamt 20 Studierenden pro Praktikumstag wurden in Untergruppen den vier Häusern der Zauberschule Hogwarts (Gryffindor , Ravenclaw , Hufflepuff , Slytherin ) sowie der Zauberschule Durmstrang zugeteilt und erhielten Anstecker mit ihrem jeweiligen
Wappen. Durch aktive Beteiligung im Vor- und Abendseminar konnten die Studierenden Punkte für ihr Haus sammeln. Am Ende des Tages hat das Haus mit den meisten Punkten den Hauspokal in Form von Süßigkeiten erhalten. Dieses Setting schuf einen spielerischen Wettbewerbsrahmen, der die Interaktivität förderte und den langen Praktikumstag auflockerte.
Die offizielle Evaluation der Studierenden der Medizinischen Fakultät Ulm aus dem Sommersemester 2025 zeigte eine positive Resonanz. Aus insgesamt zwölf Freitext- Kommentaren zu diesem Versuch waren elf positiv. Neben allgemeinen Rückmeldungen wurden insbesondere die gesteigerte Interaktivität und die verbesserte Auseinandersetzung mit den Lerninhalten betont. Ein Kommentar lautete: „Das “Hogwartsseminar” hat uns Studenten schon Freude bereitet und dabei konnte man sich auch sehr gut mit der Enzymkinetik auseinandersetzen! Eins der besten Seminare, die ich bis jetzt hatte.“
Im Sommersemester 2026 soll eine Feldstudie durchgeführt werden, die systematisch untersuchen soll, ob dieses Gamification-Element neben Motivation auch den Lernerfolg der Studierenden verbessert. Ziel ist es, einen möglichen Lernerfolg mittels eines Wissenstests und mit Hilfe einer subjektiven Erhebung die Motivation, das Interesse und die Konzentration der Studierenden zu untersuchen. Damit soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung interaktiver Lehrmethoden im Medizinstudium geleistet werden.
Keywords: Biochemieseminar, Gamification, Motivationssteigerung, Lernerfolg
Prof. Dr. Henning Bruhn-Fujimoto1 & Dr. Michael Harder2
(1Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften | Institut für Optimierung und Operations Research; 2Zentrum für Lehrentwicklung)
Mathematische Problemstellungen der beruflichen Praxis werden überwiegend mit Computerhilfe gelöst. Auch in der mathematischen Forschung kommen zunehmend Computermethoden zum Einsatz. Die universitäre Lehre hat mit dieser Entwicklung nicht immer Schritt gehalten. Im Rahmen des Projekts „ULMSoft“ wurde (und wird) daher die Ausbildung im Fachbereich Mathematik der Universität Ulm durch Prof. Dr. Henning Bruhn-Fujimoto (mit Beratung durch das Zentrum für Lehrentwicklung) modernisiert. Ein zentraler Bestandteil des Konzepts sind Skripte mit Selbstlernelementen in Matlab (Live-Skripte), R (R Markdown) und Python (jupyter notebooks). Denn Programmieren kann man nur durch eigenes Ausprobieren lernen. Die Bearbeitung kleiner Projekte, teilweise mit echten Daten, soll die Studierenden motivieren, sich mit den jeweiligen Programmen zu beschäftigen. Dabei steht immer eine mathematische Fragestellung im Vordergrund. Beim Gespräch am Poster werden Einblicke in den ersten Durchlauf gegeben und erste Erkenntnisse diskutiert.
Keywords: Mathematische Software, Selbstlernelemente, blended learning
Sonja Grübmeyer
(Zentrum für Lehrentwicklung)
Mit iwimint unterstützt Sie das Zentrum für Lehrentwicklung, Ihre Lehridee auch ohne die Einbindung in große Fördermaßnahmen umzusetzen. Dazu haben wir einen unbürokratischen Fördertopf, der für alle Ebenen der Lehre eingesetzt werden kann. Das kann eine Idee für eine Lehrveranstaltung sein, oder auch die Weiterentwicklung eines Modulhandbuchs. Wir fördern innovative Lehre durch die Bereitstellung finanzieller Mittel und individueller Beratungsleistungen in den Bereichen der Lehrentwicklung.
Sie haben eine Idee, wie Sie Ihre Lehre verbessern wollen, aber Ihnen fehlen Ressourcen, diese umzusetzen? Die Lehrentwicklung im ZLE kann Sie mit kollegialer Beratung und Vernetzung, Technik und didaktischen Ideen unterstützen. Falls Sie Sach- oder Personalmittel zur Umsetzung Ihrer Idee brauchen, können Sie einen Mikroantrag stellen. Wir bieten u.a.:
-Kooperative Überarbeitung von Lehrveranstaltungen
-Unterstützung bei Neukonzeption von Curricula
-Begleitung der Erprobung und Evaluation
-Dokumentation von Best Practices
-Vernetzung mit anderen Lehrenden
Keywords: Förderung, Lehrentwicklung, Lehrideen
Dorothee E. Hoffmann
(Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung)
Am Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) begegnen sich Studierende und Senior*innen in Seminaren, die akademisches Wissen mit gelebter Erfahrung verbinden. Das gemeinsame Lernen entsteht aus Unterschieden: zwischen Generationen, Bildungsbiografien und Perspektiven auf die Gesellschaft. Die Vielfalt der Teilnehmenden wird dabei gezielt als Ressource genutzt.
Im Seminar Zukunftsenergien arbeiten Studierende mit ehrenamtlichen Wasserstofflots*innen zusammen, die ihre Expertise aus Industrie, Politik und Wissenschaft einbringen. Im Seminar Lebenslanges Lernen reflektieren junge und ältere Teilnehmende ihre Bildungswege und Lernhaltungen und fragen, wie Lernen sich über den Lebenslauf verändert.
Als Additive Schlüsselqualifikationen (ASQ) stärken die Formate überfachliche Kompetenzen. Sie eröffnen Erfahrungsräume, in denen Wissen mit biografischen Erfahrungen, gesellschaftlicher Verantwortung und persönlichen Wertvorstellungen in Beziehung tritt. Studierende lernen, in heterogenen Gruppen zu kommunizieren, Perspektiven zu verhandeln und eigene Positionen zu schärfen. Für die Lehrenden bedeutet dies, Lernprozesse moderierend zu begleiten und Lernräume zu gestalten, in denen Autorität geteilt wird.
Intergenerationelles Lernen öffnet den akademischen Raum: Wo verschiedene Lebensrealitäten aufeinandertreffen, entstehen Gespräche, die Routinewissen infrage stellen und neue Formen gemeinsamer Erkenntnis ermöglichen.
Keywords: intergenerationelles Lernen, erfahrungsbasiertes Lernen, ASQ, Forschendes Lernen, lebenslanges Lernen
Tanja Jähnig1, Silke Lück1, Dr. med. Heike Tritschler1, Nina Möllerring1, Dr. med. Viola Kurz1, Dr. med. Klaus Böhme2 & Prof. Dr. med. Anne Barzel1
(Medizinische Fakultät | 1Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Ulm; 2Abteilung für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Ruhr-Universität Bochum)
Hintergrund und Zielsetzung: Im Rahmen des Programms „Regionen für ärztliche Ausbildung“ (Land Baden-Württemberg) wurde ein curricular verankertes Begleitprogramm zum Blockpraktikum Allgemeinmedizin entwickelt. Ziel war es, Studierenden Einblicke in regionale Versorgungsstrukturen zu ermöglichen und die Reflexion der eigenen ärztlichen Rolle zu fördern. Es wurden Machbarkeit und Optimierungspotenzial des neu entwickelten Programms evaluiert.
Methoden: Das Programm umfasste ein verpflichtendes interaktives Webinar und ein fakultatives Hospitationsangebot in regionalen Gesundheitseinrichtungen (z. B. Gesundheitsamt, Pflegeheim, Palliativversorgung). Im Sommersemester 2024 nahmen alle 140 Blockpraktikums-Studierende teil. Die Evaluation erfolgte über einen Online-Fragebogen (38 Items Webinar, n= 99, Rücklauf 70,7 %; 27 Zusatzitems Hospitationen) mit deskriptiv-quantitativer Auswertung.
Ergebnisse: Das Webinar wurde mit 2,4, die Hospitationen mit 1,5 bewertet. Letztere erzielten höhere Werte bei Relevanz, Wissenszuwachs und Lernzielerreichung. Lernziele waren: regionale Zusammenarbeit verbessern, deren Relevanz verstehen und die koordinierende Rolle der Allgemeinmedizin reflektieren. Gelobt wurden Lehrengagement und Praxisnähe; kritisch benannt wurden späte Information und unklare Aufgabenstellung.
Diskussion: In Bezug auf Relevanz und Wissenszuwachs erzielten Hospitationen deutlich höhere Werte, vermutlich durch Praxisnähe und Freiwilligkeit. Die allgemeinärztliche Rolle der Koordination und der Bezug zu den Regionen war in beiden Formaten erlebbar. Verbesserungsvorschläge hinsichtlich einer klaren Aufgabenstellung und organisatorischer Aspekte wurden bereits umgesetzt.
Take Home Message: Ein curriculares, regional verankertes Begleitprogramm zum Blockpraktikum Allgemeinmedizin kann Studierenden Einblicke in Arbeitsfelder von Kooperationspartnern der Allgemeinmedizin geben, stärkt die universitäre Vernetzung und ist in einem Regelstudiengang gut umsetzbar.
Keywords: Blockpraktikum Allgemeinmedizin Begleitprogramm Regionale Gesundheitsversorgung
Dr. Jörn Justiz1, Prof. Dr. Claudia Lenk2 & Prof. Dr. Walter Karlen1
(Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie | 1Institut für Biomedizinische Technik, 2Institut für Funktionelle Nanosysteme)
Nachhaltige Entwicklung ist in aller Munde, doch häufig wird sie auf ökologische Aspekte reduziert. Dabei umfasst Nachhaltigkeit ebenso soziale und ökonomische Dimensionen. Zudem werden Lösungsansätze oft innerhalb eines zu engen fachlichen Rahmens gesucht. Gerade in der Technik geraten „weiche Faktoren“ wie soziale Verträglichkeit und gesellschaftliche Akzeptanz leicht aus dem Blick. Wirklich nachhaltige Lösungen können jedoch nur interdisziplinär entstehen.
Unser Projekt „Sustainable Technologies“ verfolgt daher das Ziel, Interdisziplinarität nicht nur zu lehren, sondern auch zu leben. Wir entwickeln und erproben fächerübergreifende Lehrformate und Projekte, in denen Studierende technischer Studiengänge gemeinsam mit Studierenden anderer Disziplinen lernen und arbeiten.
Um das Projekt selbst nachhaltig zu gestalten, entsteht zudem eine öffentlich zugängliche Datenbank mit Unterrichtsbeispielen und Studierendenprojekten, die als Inspirationsquelle für weitere Fächer und Initiativen dienen soll. So wollen wir zur langfristigen Verankerung des Themas Nachhaltigkeit in der Lehre und an der Universität beitragen.
Keywords: Nachhaltigkeit, Interdisziplinarität, Unterrichtsbeispielen
Dr. med. Viola Kurz1, Silke Lück1, Tanja Jähnig1, Nina Möllerring1, Prof. Dr. med. Anne Barzel1
(Medizinische Fakultät | 1Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Ulm)
Hintergrund: Mit dem Ziel, allen Studierenden im Blockpraktikum relevante allgemeinmedizinische Lerninhalte zu vermitteln, überarbeiteten wir die Lernziele und definierten Aufgaben für das Blockpraktikum und die Leistungsbeurteilung.
Fragestellung: Wie setzen Studierende die Aufgaben im 10-tägigen Praktikum um? Unterscheiden sich die Aufgaben hinsichtlich der Umsetzbarkeit?
Material & Methoden: Unter Berücksichtigung des NKLM definierte ein Expertenpanel aus in Lehre und Praxis tätigen Allgemeinmediziner:innen 13 Aufgaben für das Blockpraktikum. Diese werden in der Einführungsveranstaltung erläutert und liegen den Praxen in Form eines Testat-Bogens vor. Sieben sog. Praxisaufgaben führen die Studierenden eigenverantwortlich durch, sechs Aufgaben unter Supervision mit Leistungsbeurteilung durch den Lehrarzt/die Lehrärztin. Wir analysierten die Umsetzung der Aufgaben anhand der Testatbögen aller Studierenden im Wintersemesters 2024/25 (N=154) sowie inhaltsanalytisch die Freitextkommentare der Semesterevaluation mit Bezug zum Testatbogen (n꓿41, 27%).
Ergebnisse: Die Umsetzungsrate der Praxisaufgaben lag durchschnittlich bei 75%. Auffällig waren die deutlich niedrigeren Umsetzungsraten für die Aufgaben Suchterkrankungen (48%) und Arbeitsplatz Praxis (61%). Knapp die Hälfte der Rückmeldungen aus Freitextkommentaren (46%) betrafen Schwierigkeiten bei der Umsetzung einzelner Praxisaufgaben, oft wurden fehlende Patientenkontakte als Grund angegeben.
Diskussion: Insgesamt setzten die Studierenden die neu definierten Praxisaufgaben in einem hohen Maße um. Auch Lehrpraxen meldeten zurück, dass die neu gestalteten Aufgaben die Arbeit in der Praxis gut abbilden. Lerninhalte, die nicht in jeder Praxis umgesetzt wurden, geben Anlass für Nachbesserungen der Aufgabenstellung und möglichen Schulungsbedarf der Lehrpraxen. Durch eine kontinuierliche Evaluation des Testatbogens wird Anpassungsbedarf erkannt und eine gleichwertige klinische Ausbildung in den Lehrpraxen gewährleistet.
Keywords: Blockpraktikum Allgemeinmedizin, Curriculum Allgemeinmedizin, Testatbogen
Nadine Raas & Anita Federsel
(International Office, Projektmitarbeiterinnen FIT4U)
FIT4U steht für ein Umdenken: Internationale Studierende werden nicht nur begleitet, sondern als zukünftige Fachkräfte aktiv in regionale Netzwerke eingebunden. Durch Mentoring, interkulturelle Workshops, Sprach- und Kompetenztrainings sowie Netzwerkveranstaltungen schafft das Projekt Brücken zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt.
FIT4U an der Universität Ulm wird im Rahmen der Campus-Initiative Internationale Fachkräfte durch den DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Ziel ist es, internationale Masterstudierende mit Abschlussabsicht gezielt auf einen erfolgreichen Berufseinstieg in der Wirtschaftsregion Ulm vorzubereiten. Über vier Semester hinweg werden dazu Formate in drei Kernbereichen angeboten: Studienerfolgssicherung, Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsmarktintegration. Gemeinsam mit externen Kooperationspartnern, wie der Stadt Ulm, Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm-Oberschwaben und der Agentur für Arbeit soll die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden gefördert werden. Aber auch innerhalb der Universität Ulm werden in Zusammenarbeit mit dem Career Service, der zentralen Studienberatung und dem Zentrum für Sprachen und Philologie nachhaltige Strukturen aufgebaut.
Gestalten Sie als Lehrende und Hochschulangehörige diesen Prozess mit und fördern Sie interkulturelle Offenheit in Studium und Lehre.
Keywords: Internationalisierung, Studienerfolg, Diversität, Kooperation, Fachkräftesicherung
Lea Raczkowski1, Dr. Daniel Schropp1,2 & Dr. Sabine Habermalz3
(1Zentrum für Lehrentwicklung, 2GUSE, 3International Office)
Das Projekt PROMOTES (Promoting Robust Opportunities for Mobility of Teacher Education in STEM) ist ein vom Deutschen Akademischen Austauschdienst e.V. (DAAD) im Rahmen der Förderlinie „Lehramt.International – Internationalisierung der Lehramtsausbildung“ gefördertes Modellprojekt mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Ziel des Projekts ist es, die internationale Mobilität von Lehramtsstudierenden in den MINT-Fächern zu stärken. Durch gezielte Förderung und strukturierte Begleitangebote sollen Studierende ermutigt werden, Auslandserfahrungen zu sammeln, die ihre interkulturellen Kompetenzen, sprachlichen Fähigkeiten sowie ihre persönliche und professionelle Entwicklung bereichern.
Im Rahmen von PROMOTES nehmen die Studierenden an einem interkulturellen Training teil, das den Schwerpunkt „Interkulturelles Klassenzimmer“ hat. Darüber hinaus wird ab 2026 jährlich eine internationale Summer School mit dem Fokus auf die Nutzung von KI im Schulkontext angeboten. Diese soll den fachlichen und kulturellen Austausch zwischen Lehramtsstudierenden verschiedener Länder fördern. Zudem erhalten die Teilnehmenden eine umfassende Beratung und Begleitung ihrer studienbezogenen Auslandsaufenthalte, die von vierwöchigen Praktika bis zu ganzen Auslandssemestern reichen können. Ergänzend absolvieren sie einen Sprachkurs. Nach erfolgreicher Teilnahme an allen vier Bestandteilen erhalten die Studierenden das PROMOTES-Zertifikat „Lehramt International“, das ihre internationale Lehramtsqualifikation sichtbar dokumentiert.
PROMOTES schafft damit neue Perspektiven für eine zukunftsorientierte, praxisnahe und international vernetzte Lehramtsbildung.
Keywords: Internationalisierung der Lehrkräftebildung; Interkulturelle Kompetenzen von Lehramtsstudierenden; Auslandsmobilität im Lehramt
Dr. Roberto Rojas, Prof. Dr. Harald Baumeister, Prof. Dr. Iris-Tatjana Kolassa & Prof. Dr. Dr. Olga Pollatos
(Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik & Psychologie | Institut für Psychologie & Pädagogik, Psychotherapeutische Hochschulambulanz)
Vor 10 Jahren wurde die Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Universität (PHSA) zur Erfüllung der Aufgaben der Lehre und Forschung der Klinischen Psychologie ermächtigt. Die PHSA spielt eine sehr wichtige Rolle vor allem bei der Einführung des neuen Masterstudienganges „Klinische Psychologie und Psychotherapie“. Im diesem Masterstudiengang werden den Studierenden tiefgreifende theoretische, wissenschaftliche und praktische Kenntnisse in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie vermittelt. Die berufsqualifizierenden Tätigkeiten sollten sowohl im ambulanten als auch im (teil)-stationären Setting stattfinden. Darüber hinaus werden innovative Studien im klinischen Bereich durchgeführt, insbesondere mit Patienten mit depressiven Störungen, PTBS, Essstörungen. Dabei kommen auch internet- und mobilbasierte Interventionen zum Einsatz.
Keywords: PHSA, Lehre, Forschung
Dr. Judith Schepers, Dr. Lion Schöpfer & Prof. Dr. Emma Sayer
(Fakultät für Naturwissenschaften | Institut für Botanik)
Das Ulm – Climate Adaptation and Resilience Experiment (U-CARE) zum Thema Klimawandel bietet seit Frühling 2025 Studierenden die Möglichkeit durch praktisches Lernen die Auswirkungen des Klimawandels tiefgreifend zu verstehen. Auf einer artenreichen Wiese im Botanischen Garten, der 'Wandelwiese', wurden mithilfe von passiven und wartungsarmen Methoden Klimabehandlungen auf je 2 x 2 m großen Parzellen eingerichtet. Hier können die Studierenden gleichzeitig aktive Forschungsarbeiten durchführen und wissenschaftliche Methoden kennenlernen.
In verschiedenen Kursen werden regelmäßig über mehrere Jahre verschiedene Pflanzeneigenschaften, Bodeneigenschaften, und vorkommende Invertebraten bestimmt. Digitale Sensoren messen durchgehend Temperatur und Feuchte von Luft und Boden. Somit liefern die Langzeitmessungen Datensätze, mit denen die Studierenden statistische Analysen lernen und anwenden können. Zusätzlich dient U-CARE als Plattform für einzigartige Abschlussarbeiten. So macht U-CARE sowohl das Thema Klimawandel als auch den wissenschaftlichen Prozess durch praktisches Lernen zugänglich.
Keywords: Botanischer Garten, Experiment, Pflanzen, Boden
Dr. Tatjana Spaeth1, Dr. Sandra Hübner2, Nadine Raas3 & Carlotta Reinders2
(1Zentrum für Lehrentwicklung, 2Hochschule Furtwangen, 3International Office)
Wie gestaltet man einen Studiengang, der nicht nur Studierende begeistert, sondern auch nachhaltigen Lernerfolg sicherstellt, mit Erfolg den Akkreditierungsprozess durchläuft, inklusiv ist und Studierende und Lehrende umfassend mitnimmt? Der Online-Selbstlernkurs "SEG – Studiengänge erfolgreich gestalten" bietet Antworten auf genau diese Fragen. Er richtet sich an Studiendekaninnen und -dekane, Hochschullehrende und Programmverantwortliche, die innovative, qualitativ hochwertige Studienprogramme konzipieren, umsetzen und betreuen – und all das bequem im Selbstlernformat.
Neugierig, wie der Kurs selbst strukturiert ist? Unser Poster gibt Einblicke in die didaktische und methodische Gestaltung des Kurses, der modular und interaktiv aufgebaut ist, sodass Teilnehmende flexibel und selbstgesteuert lernen können.
Sie möchten teilnehmen? Von curricularer Entwicklung über moderne Lehrmethoden bis hin zu Akkreditierung und Begleitung von Studierenden und Lehrenden: Der Kurs deckt die wichtigsten Aspekte ab, um Studiengänge zukunftsfähig zu machen. Erfahren Sie am Poster mehr zu den Inhalten, zur Anmeldung und Zertifizierung.
Sie möchten den gesamten Online-Selbstlernkurs oder einzelne Bausteine für Ihre eigenen Weiterbildungen verwenden? Der gesamte Kurs wurde unter offener Lizenz auf dem ZOERR - dem Zentralen OER-Repositorium der Hochschulen in Baden- Württemberg veröffentlicht. Die Publikationsstrategie auf dem ZOERR kann auch für Sie ein Beispiel für die Veröffentlichung komplexer und vielschichtiger Ressourcen als OER darstellen.
Keywords: Studiengangdesign, Onlinekurs, Selbstlernkurs
Dr. Annette Wettstein
(Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung)
Die Programmlinie „Akademiewochen” des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) bietet Studierenden und (Nachwuchs-)Wissenschaftler*innen Lern- und Erprobungsräume, in denen sie vom Austausch mit Bürger*innen und der Auseinandersetzung mit den Lebenswelten unterschiedlicher Generationen profitieren.
Die Begegnung findet in kleinen Arbeitsgruppen mit Seminarcharakter statt. Die Studierenden bzw. Wissenschaftler*innen üben sich in der Lehrpraxis und bereiten ein selbstgewähltes Thema für die Teilnehmenden einer Akademiewoche auf. Dabei handelt es sich überwiegend um Senior*innen aus der interessierten Bürgerschaft. Die aktive Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit dem vorgegebenen Thema soll explizit ermöglicht und gefördert werden.
Die Studierenden lernen, Wissenschaft allgemeinverständlich zu vermitteln, auf unterschiedliche Lebens- und Erfahrungswelten einzugehen, und sie üben sich in der Kommunikation mit heterogenen Gruppen.
Sie entwickeln Methodenkompetenz, erfahren Selbstwirksamkeit durch das Aushandeln unterschiedlicher Perspektiven und Wertvorstellungen und können darüber das eigene Lehrsetting reflektieren.
Exemplarisch werden zwei Arbeitsgruppen vorgestellt.
Keywords: Lernen durch Lehren, intergenerationelles Lernen, erfahrungsbasiertes Lernen
