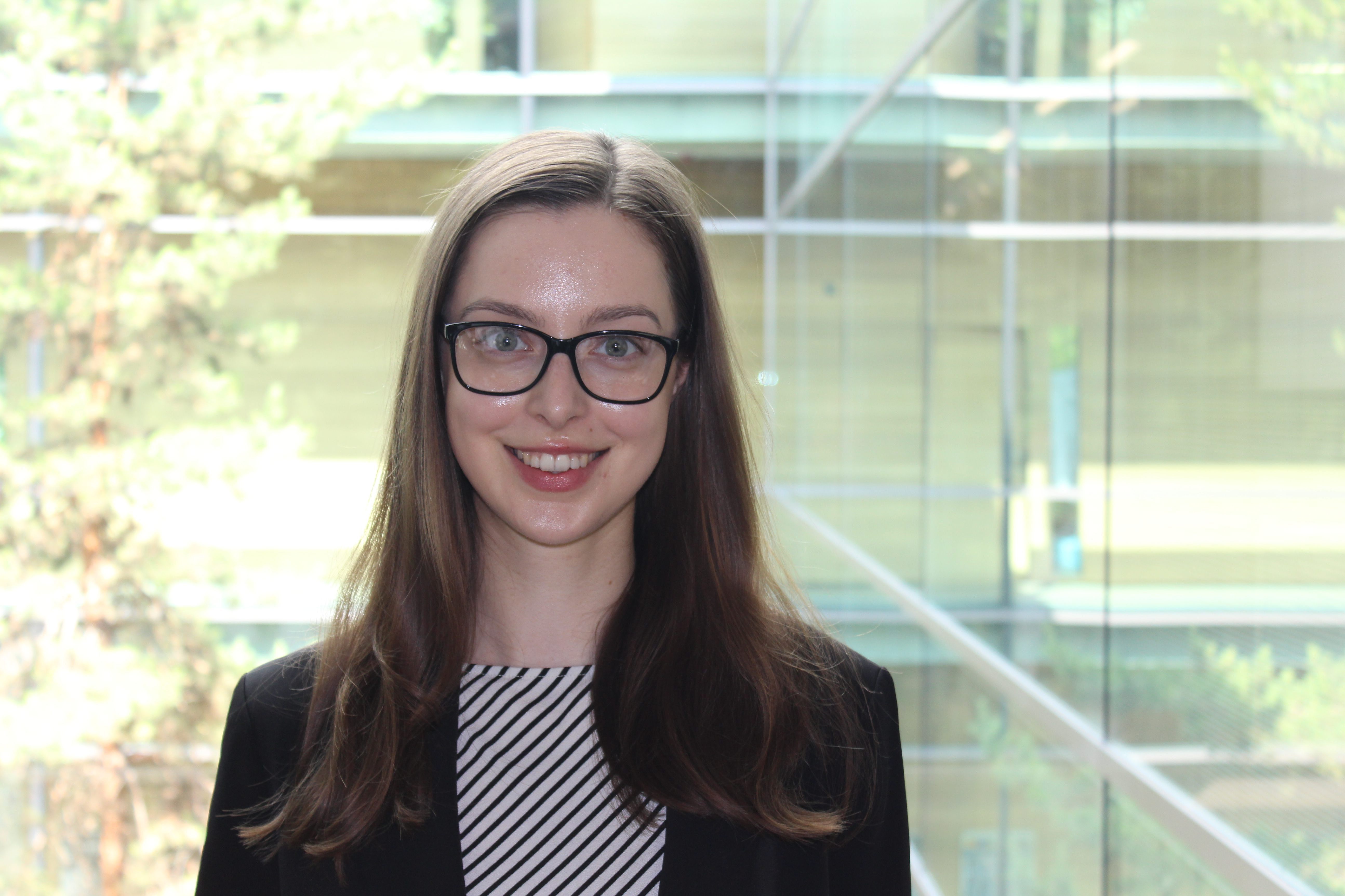Seminar Business Analytics (Bachelor / Master)

Das Seminar Business Analytics wird von Prof. Seiter angeboten und richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende.
Themen
Robotic Process Automation (RPA) ermöglicht die Automatisierung regelbasierter, strukturierter Geschäftsprozesse und hat in vielen Unternehmen zu Effizienzsteigerungen geführt. Mit dem Aufkommen von generativer und sogenannter Agentic AI entwickelt sich die Automatisierung von rein regelbasierten Abläufen hin zu adaptiven, kontextsensitiven und selbstlernenden Systemen. Diese „intelligenten Agenten“ sind in der Lage, Entscheidungen autonom zu treffen, mit anderen Systemen zu interagieren und komplexe Aufgaben eigenständig zu steuern.
Ziel der Arbeit ist es, den Übergang von klassischer RPA hin zu Agentic AI konzeptionell nachzuvollziehen. Untersucht werden sollen zentrale Unterschiede in Architektur, Funktionsweise und Anwendungsszenarien sowie die Implikationen für Unternehmen. Dabei soll insbesondere herausgearbeitet werden, welche Chancen und Herausforderungen mit dem Einsatz von Agentic AI in betrieblichen Automatisierungskontexten verbunden sind.
Mit der Entwicklung von Agentic AI entsteht eine neue Form der Automatisierung, die über klassische, regelbasierte RPA hinausgeht. Diese intelligenten Agenten können Entscheidungen autonom treffen, kontextsensitiv handeln und komplexe Aufgaben eigenständig steuern.
Ziel der Arbeit ist es, die Einsatzpotenziale von Agentic AI im Finanzbereich zu untersuchen. Anhand von zwei Fallbeispielen sollen konkrete Nutzungsszenarien aufgezeigt und bewertet werden.
Eine Data-Driven Culture beschreibt eine Unternehmenskultur, in der datenbasierte Entscheidungen systematisch gefördert, unterstützt und in den Arbeitsalltag integriert werden. Sie ist eine zentrale Voraussetzung, um das Potenzial von Business Analytics voll auszuschöpfen und datengetriebene Innovationen erfolgreich umzusetzen. Dabei geht es nicht nur um technische Lösungen, sondern vor allem um den Wandel von Mindset, Kompetenzen und Führungsstilen.
Ziel der Arbeit ist es, Erfolgsfaktoren und Hürden beim Aufbau einer datenorientierten Unternehmenskultur zu identifizieren.
Mit der zunehmenden Nutzung und Analyse großer Datenmengen wächst auch das Risiko von Datenschutzverletzungen und Sicherheitslücken. Privacy Enhancing Technologies (PETs) bieten innovative technische Ansätze, um personenbezogene Daten zu schützen und gleichzeitig deren Nutzung für Analysezwecke zu ermöglichen. Dazu zählen Methoden wie Differential Privacy, Homomorphe Verschlüsselung, Secure Multi-Party Computation oder Datenanonymisierung.
Ziel der Arbeit ist es, zentrale PETs vorzustellen und deren Potenzial für den Einsatz in datengetriebenen Unternehmen zu bewerten.
Algorithmenaversion beschreibt das Phänomen, dass Menschen algorithmischen Entscheidungen oft weniger Vertrauen entgegenbringen als menschlichen – selbst dann, wenn Algorithmen objektiv bessere Ergebnisse liefern.
Ziel der Arbeit ist es, auf Basis bestehender empirischer Studien zu analysieren, ob und in welchem Ausmaß individuelle Risikoneigungen mit Algorithmenaversion zusammenhängen.
Algorithmenaversion beschreibt das Phänomen, dass Menschen algorithmischen Entscheidungen oft weniger Vertrauen entgegenbringen als menschlichen – selbst dann, wenn Algorithmen objektiv bessere Ergebnisse liefern. Die Ursachen für dieses Verhalten sind vielfältig und bislang nur teilweise verstanden.
Ziel der Arbeit ist es, auf Basis aktueller Forschungsliteratur systematisch zu analysieren, welche Faktoren Algorithmenaversion auslösen oder verstärken und wie diese Faktoren zusammenwirken.
Visualisierungsstandards in Dashboards spielen eine zentrale Rolle für die effektive Kommunikation von Daten in Unternehmen. Gut gestaltete Dashboards ermöglichen es Entscheidungsträger:innen, komplexe Informationen schnell zu erfassen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dabei ist jedoch oft unklar, welche Visualisierungsformen, Designprinzipien und Gestaltungsregeln als „Best Practices“ gelten.
Ziel der Arbeit ist es, zentrale Visualisierungsgrundsätze und -standards aufzuarbeite. Untersucht werden sollen unter anderem Fragen der Informationsarchitektur, Farbwahl, Diagrammtypen und Interaktionsmöglichkeiten, um daraus grundlegende Empfehlungen für die Gestaltung von Dashboards abzuleiten.
Informationen
Nächster Veranstaltungsbeginn: SoSe 2026
Wichtige Termine:
- Auftaktveranstaltung: 10. Februar 2026, 16 Uhr
- Abgabe der Seminararbeiten: 6. Juli 2026, 10 Uhr
- Abschlusspräsentationen: 7. Juli 2026, 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Bachelor
- Schwerpunktfächer: Technologie- und Prozessmanagement, Business Analytics
- Studiengänge: B.Sc. Wirtschaftswissenschaften, B.Sc. Wirtschaftsphysik, B.Sc. Wirtschaftschemie, B.Sc. Wirtschaftsmathematik
Master
- Schwerpunktfächer: Technologie- und Prozessmanagement, Business Analytics
- Studiengänge: M.Sc. Wirtschaftswissenschaften, M.Sc. Wirtschaftsphysik, M.Sc. Wirtschaftschemie, M.Sc. Wirtschaftsmathematik, M.Sc. Nachhaltige Unternehmensführung
ECTS: 4
Seminar (2 SWS): Schriftliche Hausarbeit, Präsentationsunterlagen, Präsentation im Rahmen eines Seminarvortrags
Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt aufgrund der vollständigen Bearbeitung eines übernommenen Themas. Die Note der Modulprüfung ergibt sich aus den Noten der Ausarbeitung und der Präsentation. Im Transcript of Records wird die errechnete Note für die Modulprüfung als eine Prüfungsleistung eingetragen und ausgewiesen.